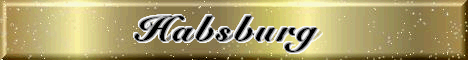
DIE BABENBERGER HABSBURGER:
(Liste der Habsburger und Babenberger Habsburger)
Die Bewertung der Abstammung von Habsburgern aus dem Haus Babenberg erfolgte nach folgenden Prinzipien:
a) Die Äußere Merkmalsgenetik:
Die äußeren Körpermerkmale sind meist ein wesentlicher Bestandteil der Wiedererkennung von Personen. Faktoren, wie Schädelform, Gesichtsproportionen, Nasenform, Augenabstand, Körpergröße, Körperproportionen, Haarfarbe, Haartypus, organische Varietäten oder Mißgeburtenmerkmale oder Syndrome (bei Habsburgern ohne Babenberger Herkunft) sind, bei Berücksichtigung der äußeren Merkmalsgenetik der leiblichen Eltern von hohem Aussagewert. Ein wichtiger
Entscheidungsfaktor ist dabei die genetische Merkmalsbreite einer Familie.
In der Herrschaftsabfolge waren es aber häufig keine Eltern-Sohn-Verhältnisse, die auftraten, sodass eine Herkunft einzelner Merkmale manchmal nicht eindeutig zurückverfolgt werden kann. Manchmal übernahm ein "Neffe" oder ein anderer Verwandter die Herrscherposition. Manchmal übernahm ein anderes Haus die Herrscherposition, ohne dass sich diese Veränderung in der Heraldik (Hauswappen, Fahne, Regalien) oder in der Abstammungsbezeichnung ("Sohn") ausdrückte.
Vorfälle, in denen "Habsburger gegen Habsburger" (Bruderzwist im Hause Habsburg) vorgingen (Beispiele: Johann Parricida, Kämpfe zwischen Franz II.(I.) und seinen sogenannten "Brüdern"), zeigen deutlich, dass zwei nicht männlich verwandte, unterschiedliche Häuser gegeneinander um die Herrschaft kämpften.
Häufig handelte es sich dabei wohl um landesfremde Häuser auf der einen Seite und um das Haus Babenberg auf der anderen Seite.
Auch überlange Herrschaftsperioden (wie bei dem sogenannten Kaiser Franz Joseph I. (1848-1916)) lassen auf mehrere unterschiedliche Herrscher innerhalb der Lebensperiode der geschichtlichen Herrscherperson schließen.
Ein weiterer Einschränkungsfaktor der Beurteilung aus der äußeren Merkmalsgenetik ist die Einbringung von Merkmalen durch die Mutter. Beim Familienportrait des Kaisers Maximilian II. (bis 1576) wird dies besonders deutlich. Das Mißgeburtensyndrom (Progenie mit vorstehendem Kinn und Höckernase sowie Mikrobulbie mit überkleinen Augen) erscheint deutlich bei diesem und bei zweien seiner Enkel, nicht jedoch bei seinem Sohn, Philipp, dem "Schönen", der fast völlig seiner Mutter Maria von Burgund ähnelt.
Trotz der äußeren Ähnlichkeit Philipp, des Schönen, mit Babenberger Merkmalen, ist bei diesem von einem nicht-Babenberger Ursprung auszugehen.
Genetische Normalmerkmale ausländischer Genpools und Mißgeburtenmerkmale werden mit der Zeit der Abstammungsfolgen an den Genpool der Frauen der Herrscher und -nachfahren angeglichen. Da dieser Genpool der Frauen der Herrscher meist "germanisch-nordisch" war, erfolgte eine Angleichung auch von Merkmalen, die im lokalen Genpool praktisch nicht vorhanden waren, an denselben. Dies erklärt die äußere Ähnlichkeit mancher Fremdhäuser zu Merkmalen des Hauses Babenberg (von Babenberg von Habsburg, von Babenberg von Hohenstaufen). Eine äußere merkmalsgenetische Ähnlichkeit allein ist also ohne Aussagekraft.
Psychische Erkrankungen besitzen keinerlei genealogische oder genetische Aussagekraft. Nach den ausführlichen Forschungen von "Ärzte gegen Folter" (Standardwerk für Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik, 1997, 2300 Seiten) existieren keine gesicherten Beweise über bestimmte, sich im Erkrankungstypus wiederholende genetische "Vererbungen" oder humangenetische Vererbungsmuster psychischer Erkrankungen. Heute sind psychische Erkrankungen als grundsätzlich streßbedingt verursacht anzuerkennen.
Die hohen exponierten Positionen der Herrscher führten (besonders zu Kriegszeiten) zu außergewöhnlichen Streßsituationen, die (auch heute noch bei Regierungsmitgliedern) zu einer erhöhten Rate psychischer Erkrankungen beitrugen.
Da sich eine Reihe von "Habsburgern" durch Mißgeburtenmerkmale abheben, ist eine genetische "Aussonderung" der Mißgeburtennachfahren, ob mit oder ohne entsprechende Merkmale, besonders einfach. Das Y-Chromosom des Mannes verändert sich in der Erbfolge kaum und besitzt daher (vor allem bei Y-chromosomalen Mißgeburtenmerkmalen deutlich) eine große Aussagekraft. Dabei sind jene Mißgeburten zu differenzieren, die sich nur aufgrund ihrer Mißgeburtenmerkmale als "habsburgverwandt" präsentieren.
Die Eliminierung der nicht-Babenberger Habsburger und deren Nachfahren ist also, bei Erlangung von Zellerbgut, insgesamt eine einfache Sache. Bei Fehlen genetischer Untersuchungen, wie in diesem Fall, sind die Aussagen lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen.
Eine weitere Frage ist allerdings, ob Sammlungen von Knochen, Schädeln, von Blut- oder Gewebeproben von Herrschern und deren Verwandten überhaupt noch von denselben stammen oder ob sie manipuliert wurden (auch genetische Untersuchungen lassen sich manipulieren).
Es liegt also an den entsprechenden Staaten und deren Staatsräson, genetische Untersuchungen durchzuführen oder dem Haus Babenberg und seinen Familien als dem Fahnen- und Gründergeschlecht derselben Staaten einen solchen Zugang zu genetischem Material zu ermöglichen.
Eine wesentliche Komponente der Ursachen oder Anlässe von Kriegen, oft sehr lange dauernden oder heftigen Kriegen mit hohen Todesraten und großen Verwüstungen in Europa ist die Abstammung. Immer wieder kämpften Staaten mit Herrschern unterschiedlicher Abstammung gegeneinander. Die Klärung und Korrektur in Richtung auf eine dominierende Herrschaft des entsprechenden Fahnen- und Gründergeschlechts eines Staates vermeidet zukünftige Kriege, wobei zu bedenken ist, dass eine solche Form eines zukünftigen Krieges ein planetenweit vernichtender Atomkrieg sein kann.
Dies zeigt, wie wichtig die Klärung der Abstammungsfragen von Herrschern im Detail ist.
b) Heraldik - Wappenkunde:
Man kann im Regelfall davon ausgehen, dass ein Herrscher seine wirkliche Herkunft in seinen Wappen repräsentiert sehen möchte. Dies ist die Funktion der Heraldik. Bei einer nicht vorhandenen höheren Abkunft jedoch (wie etwa bei "Kaiser" Maximilian I.) ist davon auszugehen, dass sich der Herrscher in der errungenen höheren Position durch die, diese Position bestätigende Heraldik, legitimieren möchte.
Grundsätzlich jedoch überwiegt meist die erste Motivation: Der Herrscher möchte seine wahre Herkunft offen präsentieren.
c) Politik und Taten:
Eine starke Aussagekraft haben die Politik und die Taten eines Herrschers/einer Herrscherin, die für oder gegen das Haus Babenberg auslegbar sind.
Kaiser Leopold I. (1657-1705) zum Beispiel stiftete um 1679 eine neue Kirche mit 4 Kreuzarmen um einen zentralen Kuppelraum auf dem "Kahlenberg" bei Wien, der seither "Leopoldsberg" genannt wird. Dies besagt eine intensive Verehrung der Babenberger, wie sie nur dann auftritt, wenn der Herrscher selbst ein Babenberger war. Kaiserin Maria Theresia ließ zum Beispiel die Herzogskrone der Babenberger renovieren, welches ebenso interpretierbar ist.
Die Politik des Herrschers und seine Kriege (für wen und gegen wen) zeigen ebenfalls deutlich seine Zugehörigkeit zu einem Haus.
d) Geschichtsfälschungen:
Es ist klar, dass Geschichtsfälschungen durch einen Herrscher ein wesentliches Mittel der Politik und der Herrschaftslegitimation darstellten (Beispiel: Privilegium Maius). "Der Sieger bestimmt das Geschichtsbild" betrifft die Geschichtsinterpretation und -darstellung vergangener Herrscher.
Aus diesem Grund sind standesamtliche Eintragungen und andere niedergeschriebene beamtete "Feststellungen" mit Vorsicht zu genießen. Dies ist auch der Grund, warum genealogische Aussagen allein ohne Beweiskraft sind.
e) Bilddarstellungen, Grafiken und Gemälde und gleichzeitige Herrscher:
Aufgrund des Auftretens unterschiedlicher Personen oder Häuser unter demselben Herrschernamen innerhalb einer Lebensperiode des entsprechenden "geschichtlichen Herrschers", wie dies bei Karl V., bei Franz II. (I.) und bei anderen offensichtlich der Fall war (es gibt in der Merkmalsgenetik völlig divergierende Portraits), ist eine letztendliche Aussage nur auf der Basis von "Genealogien" (Stammbäumen) ohne Aussagekraft.
Auch bei Napoleon gibt es unterschiedliche Darstellungen des Kaisers, eine solche mit und eines solche ohne Höckernase. Tatsächlich aber gab es wohl nie einen Napoleon mit deutlicher Höckernase (in diesem Fall also täuschen die völlig unterschiedlichen Portraits).
Beim Habsburger Kaiser Joseph II. (1780-1790) wurde das Portrait offensichtlich an das damals vorhandene Portrait der Kaiserin Maria Theresia angeglichen, wie die Analyse (Stilistik, Farbgebrauch, Kongruenzen) beider Portraits ergibt (oder beide Portraits wurden neu gemalt und aufeinander abgestimmt).
Es existiert ein Portrait Albrecht Dürers, auf dem Maximilian I. mit einer enormen Höckernase (Mißgeburt) dargestellt wird. In einem zweiten Portrait aus dem Jahr1619 von Peter Paul Rubens, wird Maximilian I. mit gerader Nase in Rüstung dargestellt. Dieses Jahr ist gleichzeitig das Jahr der Erhebung Kaiser Ferdinands II. (-1637) zum König und Kaiser. Das heißt, dass das Portrait Maximilian, des I. von 1619 nicht den Habsburger Kaiser Maximilian I. darstellt, sondern DEN Maximilian I. des Hauses des zum Zeitpunkt des Portraits neuen Kaisers Ferdinands, des II.
Die Herrscherlinien von unterschiedlichen Häusern wurden wohl ohne gegenseitiges Einverständnis manchmal parallel geführt und zwar so, dass ein anderer SELBEN Namens den Thron übernehmen konnte, ohne dass eine Änderung des Namens des Herrschers oder seiner persönlichen Daten durchgeführt wurde.
In anderen Fällen wurde nur das Portrait an das des neuen Kaisers angeglichen, ohne den Namen des nun neuen Hauses zu nennen. Alle waren einfach nur "Habsburger", während innerhalb der Länder jahrhundertelang eine Art "Bürgerkrieg" unter der Oberfläche (und manchmal völlig offen) tobte.
Untersucht man die persönlichen Verhältnisse der "Habsburger" zueinander, dann findet man fast immer den Zeitpunkt des Machtwechsels von einem Haus zu einem anderen, früheren oder völlig neuen als bewaffneten Konflikt (Albrecht VI.- Friedrich III.), Tyrannenmord (Johann Parricida) oder als Attentat.
Diese Vorgänge sind bei den einzelnen Herrscher mit ">> Bruchstelle:" markiert. Ähnliche Thronkämpfe innerhalb des entsprechenden Landes gab es wohl auch in vielen anderen Ländern Europas.
Eine weitere Tatsache ist, dass diese namensgleichen Herrscher verschiedener Häuser manchmal tatsächlich innerhalb des Landes über ein ihnen ergebenes Gebiet herrschten, sodass sie vom momentan regierenden Herrscher nicht entfernt werden konnten. Dies war wohl bei der Leopoldinisch-innerösterreichischen Linie der Habsburger (höchstwahrscheinlich eigentlich Babenberger) Realität.
Eine weitere Frage ist die, warum manche Herrscher keine Gemäldedarstellung als Imperator mit Krone, Szepter und Reichsapfel sondern nur mit Hut und Mantel in Auftrag gaben. Eine Darstellung ohne Insignien des König-/Kaisertums kann bedeuten, dass die
dargestellten Personen diese Titel in Wirklichkeit nicht innehatten. So findet man dies bei Kaiser Maximilian I., Kaiser Karl V. und Kaiser Ferdinand I (1503-1564).
f) Typisierungen der Habsburger (Babenberger) Herrscher in Gruppen:
Es ist überraschenderweise möglich, die unterschiedlichen Herrscher der Habsburger nach ihrer äußeren Merkmalsgenetik in Gruppen einzuteilen und sie damit unterschiedlichen Häusern bzw. Familien Babenbergs zuzuordnen. Die ersten 4 der folgenden 6 Gruppen sind (höchst)wahrscheinlich Babenberger Familien:
1. Leopold I., Leopold II. (ev. mit Karl VI.(II.), Maria Theresia I.), Babenberger (Mittelalter), Wolfgang Amadeus Mozart (Komponist)
2. Karl VI.(II.), Maria Theresia I., Babenberger (Mittelalter, Jasomirgot), Bourbonen (Louis XVI., Louis XVIII., Charles X.)
3. Franz II.(I.), Ferdinand I. (1835-1848), Erzherzog Johann (Steiermark)
4. Friedrich III., Ferdinand II.
5. Ferdinand I. (1521-1564, Portrait während der Lebenszeit ohne Höckernase), Maximilian II. (zweites Portrait ohne Höckernase)
6. Maximilian I., Maximilian II. (Jugendbildnis mit Höckernase), Karl V.
7. Albrecht I.
8. Rudolf II.
9. Phillip I., der Schöne (kein Babenberger), Wolfgang Amadeus Mozart (Komponist, "Alters"portrait)
g) Fragen sind wichtig:
Vor allem das Stellen und "Erfinden" von Fragen ist eine der wichtigsten Beschäftigungen in der Geschichtsforschung überhaupt. Fragen nach der Motivation von Taten und Vorgängen erhellen fast immer den Herkunftshintergrund eines Herrschers.
Als Beispiel für eine solche Frage sei die folgende angeführt:
"Seit 1663 ist der Hl. Kolomann durch Leopold III., den Hl. als Landespatron von Österreich (und Wien) abgelöst. Wer hatte den Justizirrtum Kolomann als "Vorwurf an die Babenberger" Landespatron eingesetzt ? Wer immer dies tat, war wohl kein Babenberger Habsburger. Leopold III., der Fromme wurde 1485 heilig gesprochen, die Heiligsprechung durch Papst Innozenz VIII. erfolgte unter Kaiser Friedrich III."
Insgesamt betrachtet bietet nur eine Gesamtbeurteilung aller genannten und einiger weiterer Faktoren eine sichere Basis für eine Wahrscheinlichkeitsaussage der wirklichen Abstammung eines Herrschers/einer Herrscherin, wobei hinsichtlich der Nachfahren nur die genetische Untersuchung eindeutige Aussagen liefert.
Wir nehmen aufgrund des vorliegenden Fortschritts in der Medizin und Humangenetik und des dringenden Erfordernisses für die Staatsräson mit Recht an, dass solche genetischen Untersuchungen bereits längst in Österreich und Deutschland durchgeführt wurden, etwa von Nachrichtendiensten, der Staatspolizei und/oder der Polizei, zum Beispiel über klinisch-forensische Institute. Wir hoffen, dass diese der Öffentlichkeit nicht mehr vorenthalten werden.
Die Identität von Babenbergern und Habsburgern ist sehr deutlich in der Funktion des Erzbischofs von Trier, des Babenbergers
Poppo (1016 bis 1047) als Schutzpatron der Habsburger ("Poppo von Babenberg - Erzbischof von Trier - Förderer des hl. Simeon - Schutzpatron der Habsburger"
Autor Wolfgang Schmid, Verleger: Trier : Auenthal-Verlag 1998, ISBN 3-89070-033-0).
AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN ist die "LISTE DER HABSBURGER UND DER BABENBERGER HABSBURGER" mit besonderen Merkmalen, Nachweisen und Jahreszahlen aufgeführt.